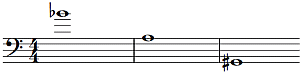


Mit der 1960 komponierten "sonate für cello solo" von Bernd-Alois Zimmermann begann in der Literatur für Cello solo eine neue Zeitrechnung. Nach den Suiten von Johann Sebastian Bach waren Solostücke für Cello eine Ausnahme, seit Zimmermanns Solosonate finden sich Cello-Solostücke im Werk fast jedes Komponisten. Gleich im ersten Jahrzehnt entstand eine Reihe von Stücken, die man mittlerweile als Klassiker bezeichnen kann. Neben Zimmermanns sonate sind dazu "nomos alpha" von Iannis Xenakis, "Pression" von Helmut Lachenmann und "Glissées" von Isang Yun zu rechnen.
Diese Alten Meister stehen im Mittelpunkt meiner neuen Reihe von Cello-Solokonzerten. Kombiniert werden sie - wie schon in der Vorgängerreihe "Bach.heute" - mit zeitgenössischer Musik. Ziel ist es, damit einen neuen Kontext zu schaffen, in dem auch die Alten Meister sich wieder neu behaupten müssen.
Nach dem Prolog im Jahr 2014 mit den 4 Meisterwerken wird Jahr für Jahr eines der Stücke der Schwerpunkt eines Programmes. Es steht am Anfang und Ende des Konzertes und bestimmt auch den Titel des Abends. Das Ausgangsstück und dieser Titel stellen den doppelten Referenzpunkt dar, an dem sich Komponisten orientieren sollen, denen für die Reihe ein neues Stück für Cello solo in Auftrag gegeben wird. Zu altem und neuem Stück tritt jeweils noch ein bestehendes Werk aus der Zwischenzeit.
Das alte Stück wird zum Anfang zunächst unkommentiert erklingen, im Laufe des Konzertes werden dann aber Besonderheiten sowohl dieses Werkes als auch der anderen Stücke und damit auch ihrer Zusammenstellung kommentiert und an Beispielen verdeutlicht.
Auf dieser Seite finden sich zu den einzelnen Stücken kurze Kommentare, die auch die Frage betreffen, wieso ihnen die jeweiligen Begriffe zugeordnet sind und wieso ich die Werke für Meisterwerke halte. Sie entstammen dem Prolog-Konzert, in dem ich die erwähnten Beispiele (und ein paar mehr) jeweils gespielt habe. Insofern kann der Text nur ein Ersatz sein, Beispiele gibt es dann inden kommenden Konzerten wieder zu hören.
Programm:
Die Termine und Orte:
Zu Bernd-Alois Zimmermann gehört der Begriff Zeit. Physikalisch ist Gegenwart ja nicht greifbar, immer wenn ich "jetzt" sage, ist es schon wieder vorbei. Wenn ich "gleich" sage, liegt es noch in der Zukunft. In unserer Wahrnehmung gibt es aber selbstverständlich Gegenwart, dieses physikalische Nichts dehnt sich also in Zukunft und Vergangenheit aus. Die einfachste Methode, mit der Zimmermann versucht hat, eine solche Ausdehnung zu komponieren, ist die Spiegelung.
Das läßt sich auf verschiedenen Ebenen das ganze Stück über wieder finden, nur weil es mich so begeistert ein Beispiel, das wirklich das ganze Werk umfaßt:
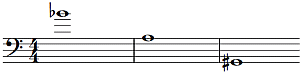 |
 |
| Die ersten drei Töne der sonate | Die letzten drei Töne der sonate |
Natürlich könnte man auch sagen, das sei zweimal das Gleiche, nur von unterschiedlichen Tönen ausgehend. Soweit ich Zimmermann aber verstanden habe bin ich mir sicher, daß es hier um eine Punktspiegelung geht, was vom Resultat her vielleicht das selbe ist, gedanklich aber doch anders.
Wieso Zimmermann ein Meisterwerk ist: Etwas wie diese Spiegelungen hat er nicht als Selbstzweck gemacht, sondern sich immer daran orientiert, wie er sich vorstellt, daß der Wahrnehmungsprozess abläuft. Und das Großartige ist: Es funktioniert!
Programm:
Die Termine und Orte:
Zu nomos alpha von Iannis Xenakis gehört der Begriff Raum. Sein Stück ist radikal anders als Zimmermanns sonate, eigentlich interessiert er sich für die Zuhörer (wie auch für den Spieler) gar nicht. Er beschäftigt sich mit Klängen. Hinter nomos alpha steht eine ganze Menge Mathematik, wir werfen einen kleinen Blick dahinein.
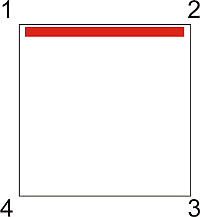 |
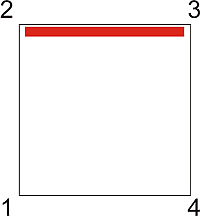 |
Wir sehen hier ein Quadrat, dessen Ecken mit 1 - 4 bezeichnet sind. Sagen wir als Regel: Jede Zahl bezeichnet eine Tonhöhe, die beiden Tonhöhen beim roten Strich erklingen gleichzeitig. Im zweiten Bild ist das Quadrat um 90 Grad nach links gedreht, statt Ton 1 und 2 erklingen jetzt also Ton 2 und 3 miteinander.
Wir können uns vorstellen, wie das Quadrat weiter gedreht wird, bis es nach vier Drehungen wieder in der gleichen Position ist. Für einen Mathematiker ist es aber nicht das Selbe, sondern es ist nach 4 Rotationsschritten eine Abbildung auf sich selber. Wie die Spiegelung bei Zimmermann ist auch hier das Ergebnis gleich, der Gedanke dahinter aber ein anderer. Der vierte von sechs großen Teilen beginnt mit einer Konstruktion dieser Art.
Was ist damit gewonnen? Zum Einen ist dies ein universelles Werkzeug. Wir können uns vorstellen, daß die Ecken etwas anderes als Tonhöhen bezeichnen. Natürlich kann man auch von 5-, 6-Ecken oder noch größeren Mengen ausgehen. Zum Anderen ist es eine Methode, eine begründetet Auswahl zu treffen. Wir haben 4 Töne, die jeweils in Zweiergruppen zusammen klingen. Aus 4 Tönen kann man aber 6 Zweiergruppen bilden, diese Methode trifft eine Auswahl, wieso nur 4 vorkommen. So abstrakt wie diese Vorarbeit ist auch das Resultat. Am Besten kann ich mir auch das Ergebnis räumlich vorstellen. Eine Fläche, die durch die Tonhöhen gerastert ist, auf der es Linien, Punkte, Gruppen gibt.
Soweit sind wir noch im zweidimensionalen Raum. Xenakis hat aber kein Quadrat, sondern einen Würfel und seine Rotationen zugrunde gelegt. Und auch das Ergebnis wird dreidimensional.
Wenn wir einen Ton mit steigender oder sinkender Tonhöhe hören, ist es für die meisten sicherlich eine Aufwärts- bzw. Abwärtsbewegung. Ein Ton der lauter wird hingegen bewegt sich von hinten nach vorne - basierend auf unserer Alltagserfahrung, daß etwas lauter wird, wenn es näher kommt. Das ganze Stück kann man sich als eine Ansammlung von Objekten im Raum vorstellen, die unterschiedliche Farben, Richtungen und Oberflächen haben.
Wieso Xenakis ein Meisterwerk ist: Es ist die Konsequenz, mit der er das durchgeführt hat. Womit er uns ganz neue Möglichkeiten von Musik erschließt. Und auf der anderen Seite deutlich macht, wie sehr Klänge immer mit unserer gesamten Lebenserfahrung verbunden sind (z.B. laut = nah, leise = fern). Sicher bilden sich beim Hören auch dieser Musik viele Assoziationen. Es spricht nichts dagegen, sie zu haben, es ist aber wichtig zu wissen, daß Xenakis, wenn wir z.B. ein nahendes Flugzeug hören, das nicht komponiert hat. Er hat nur etwas komponiert, das für uns so klingt, als wäre es dies oder das.
Programm:
Die Termine und Orte:
Zu Lachenmann - auch wenn der Name das Stückes dem entgegensteht - gehört der Begriff Leichtigkeit. Im Grunde denke ich, daß ich das gar nicht mehr begründen muß, wenn ich das Stück erst einmal gespielt habe. Lachenmann hat, nicht nur im Gegensatz zu Zimmermann sondern auch zu Xenakis, alles, was man bisher über Cellospielen wußte hinter sich gelassen. Bis auf eine Stelle kommt "normales Spiel" nicht vor. Und damit wird deutlich, daß dieses "normale Spiel" eben nur ein Sonderfall aus allen Möglichkeiten ist.
Lachenmann komponiert das, was beim normalen Cellospiel ohnehin passiert - und all das, was man auch noch machen könnte. Ich spiele den Anfang:
Beispiel Anfang
Diese Rutschen auf den Saiten habe ich bei Xenakis auch ständig gemacht, man hört es nur nicht, weil ich dazu immer streiche. Was auch heißt: Lachenmann läßt den normalen Celloklang nicht weg, um irgendwie in Sack und Asche zu gehen, sondern um den Blick frei zu machen auf etwas, was sonst dahinter verschwinden würde.
Wieso Lachenmann ein Meisterwerk ist: Er experimentiert nicht einfach nur mit neuen Celloklängen, die er uns in dann quasi in einem Katalog vorstellt. Nein: Die ganze Komposition ist strukturell eng miteinander verknüpft. Auch dafür ein kleines Beispiel.
Beispiel: 2. Seite, streichen in den Bogenhaaren.
Das ist dem Anfang ganz ähnlich: Es gibt eine kontinuierliche Bewegung, zu der einzelne Impulse treten. Nur ist das Ganze um 90 Grad gedreht. Als nächstes folgt eine Drehung der Bogenbewegung um 90 Grad, also Streichen die Saiten entlang. Der dabei entstehende "perforierte Klang" wird aufgegriffen und klanglich weiterverarbeitet, bis ich mit der Bogenstange von unten an die Saiten klopfe.
Es gibt immer wieder Stücke, die Musik mit ungewöhnlichen Klangerzeugern machen und sich dann darauf beschränken, z.B. mit Schneebesen bekannte Rhythmen zu klopfen. Das ist natürlich völlig unspezifisch. Lachenmanns "Pression" hingegen ist ganz klar für das Cello seine Möglichkeiten komponiert.
Programm:
Die Termine und Orte:
Isang Yun schließlich hat als Begriff Balance. Glissées ist der Versuch, östliche und westliche Musikkultur miteinander zu verbinden. Für die Tonhöhen benutzt er, wie übrigens auch Zimmermann, die Zwölftontechnik, eine zutiefst westliche Erfindung. Die Oberfläche des Stückes, das was tatsächlich zu hören ist, ist aber östlich geprägt. Der Grund dafür liegt im Umgang damit, was unter "Ton" zu verstehen ist. Für uns ist ein Ton sozusagen das Atom dessen, aus dem Musik zusammengesetzt ist. Für Yun ist Ton immer schon etwas Zusammengesetztes. Auch ein westlicher Ton hat natürlich einen Beginn, einen Verlauf und ein Ende. Yun komponiert das aber detailliert aus.
Beispiel: Anfang IV.
Bei der letzten Bunten Republik (einem Stadtteilfest in Dresden) gab es einen Stand, an dem man sich seinen Namen mit chinesichen Schriftzeichen schreiben lassen konnte. Nicht nur, daß das Resultat schön ist, es war auch sehr interessant, der Entstehung zuzuschauen. Komplizierte Formen werden mit einem Pinselzug gemacht, zu dem unterschiedliche Richtungen und unterschiedlicher Druck für unterschiedliche Dicken gehört. Yuns Musik erinnert mich sehr an solch ein kalligraphisches Arbeiten.
Wieso Yun ein Meisterwerk ist: Es ist genau diese Ausbreitung zum östlichen Verständnis des Tones, der immer wieder ganz unterschiedlich ist. Und genauso die Balance, die Yun immer wieder auch zwischen großen Gegensätzen herstellt. Und die er das ganze Stück über hält.
Programm:
Die Termine und Orte:
Am Anfang der Reihe stand das Konzert mit allen alten Meistern. Was wäre logischer, als sie mit einem Konzert zu beenden, in dem alle vier Stichpunkte der Jahre 2015-2018 anhand der neu entstandenen Stücke noch einmal aufgegriffen werden.
Programm: